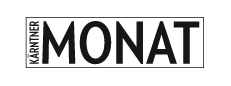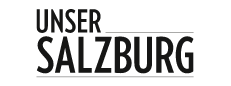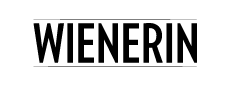Ekaterina Degot (geb. 1958, Moskau) ist Kunsthistorikerin, Kuratorin und Autorin. Seit 2018 ist sie Intendantin und Chefkuratorin des Festivals steirischer herbst in Graz, zuvor künstlerische Leiterin der Akademie der Künste der Welt, Köln. Degot kuratierte zahlreiche internationale Ausstellungen und Biennalen, darunter die erste Bergen Assembly (2013) und die 1st Ural Industrial Biennial (2010). Zudem lehrte sie an Universitäten in Europa und den USA und publiziert regelmäßig in führenden Kunstmagazinen wie Artforum, Frieze und e-flux. © Martin Schönbauer
Wie kann man über Frieden reden, wenn Kriege Normalität sind? Die Intendantin des steirischen herbst Ekaterina Degot über widersprüchliche Orte, politische Verantwortung der Kunst – und warum Lachen manchmal der ernsthafteste Zugang ist.
Seit 2018 leitet Ekaterina Degot eines der progressivsten Kulturfestivals Europas: den steirischen herbst. Mit der diesjährigen Ausgabe unter dem Titel „Never Again Peace“ setzt sie sich erneut mit den Widersprüchen der Gegenwart auseinander – zwischen Geschichtsaufarbeitung, demokratischer Erschöpfung und künstlerischer Freiheit. Im Gespräch gibt sie Einblick in den kuratorischen Prozess, aktuelle Herausforderungen – und ihre Hoffnung auf Begegnung durch Kunst.
Wir befinden uns in der ehemaligen Destillerie Bauer, wo die Aufbauarbeiten zur Ausstellung von „Never Again Peace“ gerade stattfinden. Wie erleben Sie die Zeit zwischen zwei Festival-Ausgaben?
Ekaterina Degot: Tatsächlich ist meine Arbeit an der kommenden Ausgabe oft früher abgeschlossen, als man denkt. Die künstlerische Konzeption steht, das Team arbeitet bereits intensiv an der Umsetzung. Für mich beginnt im Kopf schon das nächste Festival – noch unfertig, ohne feste Form, aber voller Ideen. Genau das ist stressig: die Unsicherheit, die Leere vor dem nächsten Konzept. Aber auch spannend. Im Herbst, bei der Eröffnung selbst, bin ich dann ganz präsent: Ich sehe mir alles an, spreche mit Künstler:innen, Publikum, versuche zu verstehen, wie unsere Ideen ankommen.
Ihr diesjähriges Motto ist „Never Again Peace“. Wie kam es dazu?
Das war ein Prozess. Einerseits wollten wir auf die politische Gegenwart reagieren – auf Kriege, die kein Ende finden. Die Aussage „Nie wieder“ hat an Bedeutung verloren, wird fast leer zitiert. Und dann stieß ich auf Ernst Tollers Komödie „Nie wieder Friede“ von 1934. Eine antifaschistische Satire, die schon damals zeigte, wie wenig Worte bewirken können. Die Verbindung von Geschichte und Gegenwart war plötzlich klar. Und: Wir wollten bewusst mit Ironie arbeiten. Humor ist ein Mittel, um das Unerträgliche auszuhalten – und um tiefere Fragen zu stellen.
Der Ausstellungsort ist heuer die ehemalige Destillerie Bauer – was hat Sie an diesem Ort besonders interessiert?
Das Gebäude ist ein Mikrokosmos: Industrie trifft auf ehemalige Polizeibüros, auf leerstehende Wohnungen. Für mich eine Art Metapher für unsere Gesellschaft – widersprüchlich, zusammengewürfelt, manchmal unfreiwillig vereint. Fast wie ein Schiff, das in unbekannte Richtungen fährt, mit Menschen an Bord, die sich nicht gewählt haben. Genau dieser Zustand hat mich fasziniert – und passt perfekt zu unserem diesjährigen Thema.

Die Festivaleröffnung am Freiheitsplatz ist ein bewusster Eingriff in den öffentlichen Raum. Was möchten Sie damit aussagen?
Der Freiheitsplatz heißt so seit 1938 – und das war keine demokratische Namensgebung, sondern ein Produkt des Nationalsozialismus. Wir wollten genau da ansetzen: Was bedeutet Freiheit heute? Für wen? Der Ort selbst trägt diese Widersprüche in sich. Es geht uns darum, solche Kontexte sichtbar zu machen – nicht mit dem moralischen Zeigefinger, sondern als Einladung zur Reflexion.
Stichwort Kulturpolitik: Sie äußerten sich kritisch zur Position der Kultur in der Steiermark. Was genau fehlt Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, es fehlt ein klares Selbstverständnis. Die Steiermark hat eine reiche Kulturgeschichte, aber zu oft ruht man sich auf Vergangenem aus. Dabei wäre es klug, progressive Kultur wie den steirischen herbst in die Identität einzuschreiben. Kulturförderung ist wichtig, aber noch wichtiger ist, dass man versteht, warum man sie fördert – nicht als Pflicht, sondern als Teil einer gesellschaftlichen Vision.
Sie betonen oft, dass Kultur „Denken ermöglicht“. Wie wird dieser Anspruch konkret im Programm sichtbar?
In vielen Formen. Wir zeigen keine „gefällige“ Kunst – unsere Arbeiten fordern oft heraus, irritieren vielleicht. Aber genau das bringt Menschen zum Nachdenken. Und wir bieten sehr viele Vermittlungsformate an: Führungen, Gespräche, Workshops – auch für Menschen, die keinen klassischen Kunstdiskurs gewohnt sind. Das Festival ist kein Elfenbeinturm – es ist offen für alle, die neugierig sind.
Gibt es spezielle Angebote für junge Menschen oder Schulen?
Ja, unsere Vermittlungsabteilung arbeitet ganzjährig mit Schulen zusammen. Während des Festivals gibt es Workshops, Plakatprojekte, Theaterbesuche – auch in Zusammenarbeit mit dem Stück „Nie wieder Friede“. Kinder gestalten ihre eigenen Botschaften zu gesellschaftlichen Themen. Uns ist wichtig, dass kulturelle Teilhabe früh beginnt – nicht erst im Erwachsenenalter. Die nächste Generation ist nicht nur das zukünftige Publikum, sondern auch die Zukunft der Demokratie.
Wenn Sie auf Ihre bisherige Zeit beim steirischen herbst zurückblicken – ist 2025 das intensivste Thema bisher?
Vielleicht das konsequenteste. Aber meine erste Ausgabe 2018 hieß „Volksfronten“ – auch da ging es um gesellschaftliche Spaltungen. Ich hatte gehofft, dass wir uns seither in eine andere Richtung entwickeln. Aber die Fronten sind geblieben, vielleicht schärfer als je zuvor. Deshalb kehren manche Themen wieder – nicht aus Mangel an Ideen, sondern weil die Realität sie ständig neu aufwirft.
Eine persönliche Frage zum Schluss: Werden Sie – als gebürtige Russin – oft auf den Krieg in der Ukraine angesprochen?
Anfangs ja. Heute kaum noch. Vielleicht, weil die Hoffnung geschwunden ist. Vielleicht, weil alle wissen, dass dieser Krieg so schnell nicht enden wird. Aber ich sehe es als meine Verantwortung, offen zu sprechen. Ich habe ukrainische Künstler:innen im Programm, ich spreche über diese Themen – nicht als Politikerin, sondern als Intellektuelle, die auf Realität reagiert. Schweigen wäre der bequemere Weg. Aber nicht der richtige.
Bei aller Schwere: Gibt es Hoffnung? Oder ist die künstlerische Arbeit auch ein Gegenmittel zur politischen Ohnmacht?
Ich glaube an die Kraft von Begegnung – auch im Kleinen. Ich kenne Organisationen, in denen Israelis und Palästinenser, Ukrainer und Russen gemeinsam arbeiten. Diese Kooperationen sind anspruchsvoll, oft fragil, aber sie existieren. Das ist Hoffnung. Kunst kann solche Räume schaffen – Räume, in denen Dialog überhaupt möglich bleibt. Auch wenn das politische Klima düster ist.
Und für alle, die den steirischen herbst noch nie besucht haben – warum lohnt sich ein Besuch gerade in diesem Jahr?
Weil man etwas erlebt, das man so nirgendwo sonst sieht. Es gibt Performances, Ausstellungen, Gespräche – und Orte wie die Destillerie Bauer, die man sonst nie betreten würde. Man kann Kunst sehen, Wein trinken, diskutieren, Musik hören. Und vielleicht mit neuen Fragen nach Hause gehen. Das ist für mich der schönste Erfolg: Wenn der steirische herbst nicht nur unterhält, sondern weiterwirkt.
Steirischer Herbst
Vom 18. September bis zum 12. Oktober sucht die 58. Ausgabe des steirische herbst unter dem Titel „Never Again Peace“ mit Performances, Musik, Literatur und einer Ausstellung in einem zentralen Industrieleerstand in Graz Gedankenwege in eine friedlichere Zukunft. Wie gewohnt wird das Festival vom ORF musikprotokoll, dem Literaturfestival Out of Joint und einem breit gefächerten Partnerprogramm begleitet.
Alle Informationen auf www.steirischerherbst.at
Das könnte dich neben Ekaterina Degot auch interessieren:
Weitere Artikel zu diesem Thema
Lifestyle
5 Min.
Mauritius: Die Perle des Indischen Ozeans
Zwei außergewöhnliche Resorts, kulinarische Highlights, Wellness pur und tiefe Einblicke in Kultur und Geschichte
Unsere Redakteurin Laura Jenewein ist nach Mauritius gereist und zeigt, warum die Insel mehr als ein Sehnsuchtsort ist. Es ist Anfang Jänner, ich sitze auf der Terrasse und höre dem Rauschen der Palmenblätter zu. Klingt aus Tiroler Sicht eher wie ein sehnlicher Tagtraum, oder? Das Vibrieren meines Handys lässt mich meine Augen wieder öffnen, doch … Continued
5 Min.
Mehr zu Lifestyle

Abo