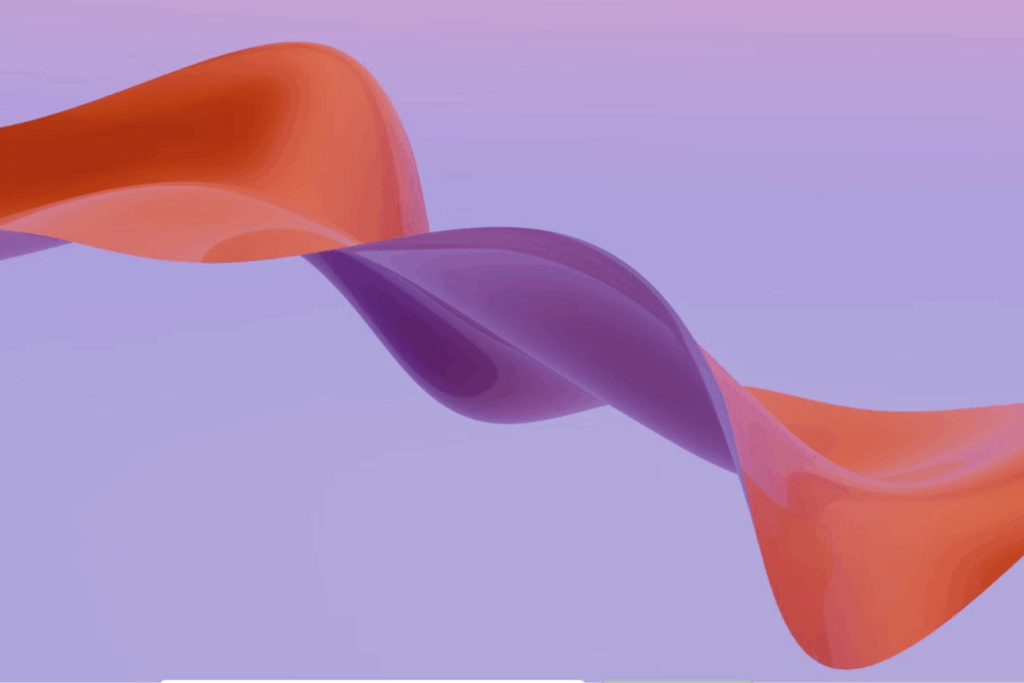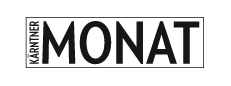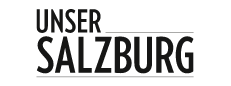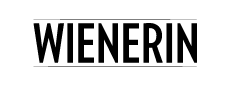Assistierter Suizid: Wenn Sterben zur Entscheidung wird
Wie selbstbestimmt darf ein Mensch in Österreich sterben – und was braucht es dafür?
© Shutterstock
Der Tod bleibt das letzte Tabu. Doch seit der Fall Niki Glattauer Schlagzeilen machte (Anm: er beendete sein Leben Anfang September 2025 selbstbestimmt durch assistierten Suizid), rückt die Frage ins Zentrum: Wie selbstbestimmt darf ein Mensch in Österreich sterben – und was braucht es dafür?
Als der Autor Niki Glattauer im September 2025 sein Leben durch einen assistierten Suizid beendete, war das kein stilles Verschwinden. Es war ein bewusst gesetztes Zeichen. Der ehemalige Lehrer, Journalist und Buchautor, der an einem unheilbaren Gallengangkrebs litt, sprach offen über seinen Entschluss – über Schmerz, Angst, aber auch über das Bedürfnis, das eigene Ende selbst zu gestalten. Österreich hörte hin. Zumindest für einen Moment.
Doch das Thema verschwand schnell wieder hinter juristischen Begriffen und moralischen Fronten. Zwischen Freiheit und Furcht bleibt der assistierte Suizid eine Grenzlinie: erlaubt, aber kaum bekannt; legal, aber voller Fragen. Wie läuft das ab? Wer darf diesen Weg gehen?

Eine, die es genau weiß, ist Katharina Spora. Die Anästhesistin und Palliativmedizinerin arbeitet im Krankenhaus Zell am See, ist Notärztin und Flugrettungsstützpunktleiterin. Sie hat Menschen am Lebensende begleitet – in Pflegeheimen, auf der Intensivstation und bei einem assistierten Suizid. Im Gespräch mit der BURGENLÄNDERIN erklärt sie, warum Selbstbestimmung nicht mit Egoismus zu verwechseln ist, wie das Gesetz tatsächlich funktioniert und wo unsere Gesellschaft beim Sterben noch immer versagt.
Frau Spora, seit 2022 ist der assistierte Suizid in Österreich unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Was bedeutet das konkret?
Kurz gesagt: Wer schwer krank ist, unheilbar leidet und entscheidungsfähig bleibt, darf über das eigene Lebensende bestimmen. Das Gesetz heißt Sterbeverfügungsgesetz und trat am 1. Jänner 2022 in Kraft. Es erlaubt die Beihilfe zur Selbsttötung – aber nicht ein „Sterben auf Verlangen“. Das ist wichtig: Niemand darf einem anderen den Tod verabreichen. Der letzte Schritt muss immer vom Menschen selbst ausgehen.
Wie läuft so ein Prozess ab?
Zuerst braucht es zwei ärztliche Aufklärungsgespräche. Einer der Ärzt*innen muss eine palliativmedizinische Ausbildung haben, die/der andere kann Haus- oder Fachärzt*in sein. Beide müssen bestätigen, dass eine schwere, unheilbare Krankheit vorliegt und der Mensch entscheidungsfähig ist. Zwischen dem ersten Gespräch und der notariellen Sterbeverfügung liegt eine Frist von zwölf Wochen – als Schutz vor Kurzschlussreaktionen. Wenn jemand in der terminalen Phase einer Krankheit ist, wenn der Tod also in den nächsten sechs Monaten zu erwarten ist, kann diese Frist auf zwei Wochen verkürzt werden.
Danach wird bei einem Notar die Sterbeverfügung aufgesetzt. Darin steht genau, wer das Medikament beziehen darf – denn nur die betroffene Person selbst oder eine von ihr benannte Vertrauensperson darf es in der Apotheke abholen. Das Präparat heißt Natrium-Pentobarbital – ein starkes Narkotikum, das bei korrekter Dosierung schnell wirkt. Die Atmung wird langsamer und schließlich kommt es zu einem Atemstillstand und in Folge zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand. Bei oraler Einnahme tritt der Tod innerhalb von ca. 60 Minuten ein, abhängig von Alter und Erkrankung. Intravenös geht es innerhalb von wenigen Minuten.
Wie viel Eigenverantwortung ist in diesem Prozess gefordert?
Enorm viel. Die Person muss das Medikament selbst einnehmen oder selbst die Infusion öffnen. Wenn das jemand anderer macht, wäre das „Sterben auf Verlangen“ – und das bleibt strafbar. Das bedeutet: Gelähmte, Demente oder Menschen, die motorisch nicht mehr in der Lage sind, den letzten Schritt zu tun, sind ausgeschlossen. Das klingt hart, aber das Gesetz will jede Form des Missbrauchs verhindern.
Wie erleben Sie als Ärztin das, wenn Sie Menschen beim assistierten Suizid begleiten?
Es ist ruhig, geordnet, friedlich. Ich erinnere mich an eine Patientin mit neurologischer Erkrankung – sie wusste seit Monaten, wann sie gehen wollte. Wir haben viel gesprochen, sie war völlig klar. Als der Moment kam, war es kein Sterben im Schmerz, sondern ein bewusster Abschied. Ich habe in dieser Ruhe eine Form von Würde erlebt.
Wie steht es um die Kosten und formalen Hürden?
Ärztliche Aufklärungen kosten etwa 160 Euro pro halbe Stunde, dazu kommen notarielle Gebühren. Das Honorar der begleitenden Ärzt*innen ist sehr unterschiedlich. Insgesamt kann der Prozess – inklusive Vorbereitung und Notarkosten – rund 1.200 Euro kosten. Das ist viel Geld, wenn man bedenkt, dass die Betroffenen ohnehin in einer extremen Situation sind.
Wie reagieren Angehörige?
Sehr unterschiedlich. Manche verstehen es, andere verzweifeln. Wichtig ist Transparenz. Wenn Familien sehen, wie groß das Leid ist, können sie den Wunsch oft akzeptieren. Ich habe erlebt, dass der gemeinsame Abschied, wenn alle im Boot sind, unglaublich heilsam sein kann. Es ist kein Fluchtakt – es ist ein bewusstes Gehen.
Kritiker*innen sagen, das Gesetz öffne Tür und Tor für Druck auf alte oder kranke Menschen.
Das höre ich oft, aber die Realität sieht anders aus. Der Weg ist so lang, so bürokratisch und so kontrolliert, dass niemand „gedrängt“ werden kann. Zwischen Antrag, Aufklärung, Frist und Verfügung liegen Wochen oder Monate. Und jeder Schritt verlangt ärztliche, notarielle und psychische Bestätigung. Die größere Gefahr liegt in der anderen Richtung: dass Menschen, die wirklich leiden, keine Hilfe finden.
Wo liegen aus Ihrer Sicht die größten Lücken?
In der Palliativversorgung. Es braucht mehr Hospizplätze, mobile Teams, psychologische Unterstützung – vor allem im ländlichen Raum. Es braucht Aufklärung, was Palliativmedizin ist. Gute stationäre Palliativmedizin bedeutet, dass Menschen derart gut versorgt werden, dass sie wieder nach Hause gehen können und an Lebensqualität gewinnen. Palliativ ist nicht nur als Sterbebegleitung zu sehen (das wäre Hospiz), sondern sollte so früh wie möglich in die Versorgung von chronischen Erkrankungen eingebracht werden.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Mehr Ehrlichkeit. Wir reden über Schönheit, Jugend, Fitness – aber nicht über Sterben. Dabei betrifft es uns alle. Ich wünsche mir, dass wir lernen, Tod und Leben wieder als Teil eines Ganzen zu sehen. Und dass jeder Mensch das Recht bekommt, den letzten Schritt in Würde zu tun – begleitet, informiert und ohne
Angst.
Assistierter Suizid in Österreich
Daten des Bundesministeriums mit Stand 1. September 2025: 772 Sterbeverfügungen wurden errichtet, 636 Präparate wurden ausgegeben, 99 davon wurden in Apotheken zurückgegeben.
Eine Aufteilung nach Bundesländern wird vermieden, denn die Anzahl der Assistierten Suizide (AS) hängt sehr von der Bereitschaft zu berichten ab. Wenn z. B. aus dem Burgenland kaum oder gar keine AS berichtet werden, dann bedeutet das nicht, dass dort keine stattgefunden haben. Die bisher am häufigsten genannten Motive für einen durchgeführten AS sind unzureichend gelinderte körperliche Symptome, Leiderleben und Angst vor möglicherweise künftigem Leid bzw. leidvollem Sterben.
Mehr Infos: www.ascirs.at
Gesetzliche Grundlage:
Seit 1. Jänner 2022 ist die Beihilfe zum Suizid durch das Sterbeverfügungsgesetz (§ 78 StGB) erlaubt. Aktive Sterbehilfe bleibt verboten.
Voraussetzungen:
- Volljährigkeit und Entscheidungsfähigkeit
- Schwere, unheilbare oder dauerhaft leidvolle Erkrankung
• Zwei ärztliche Aufklärungsgespräche (eines durch Palliativmediziner*in) - Notarielle Sterbeverfügung
- 12 Wochen Bedenkzeit (verkürzt auf 2 Wochen bei terminaler Erkrankung)
Ablauf:
Nach der zweiten ärztlichen Aufklärung kann beim Notar die Sterbeverfügung errichtet werden. Danach darf das Medikament Natrium-Pentobarbital in einer Apotheke bezogen werden – nur durch die betroffene Person oder eine benannte Vertrauensperson. Die Einnahme erfolgt eigenständig bzw. kann begleitet werden.
Kosten:
Rund 800 bis 1.500 Euro (ärztliche Aufklärung, notarielle Beglaubigung, ggf. Begleitung)
Wichtig:
Menschen mit Demenz oder fehlender Handlungsfähigkeit sind ausgeschlossen. Der Wille muss schriftlich und eigenhändig dokumentiert werden.
Hilfs- und Informationsstellen im Burgenland:
Derzeit ist das Burgenland noch das einzige Bundesland, das über kein stationäres Hospiz verfügt. 2026 soll in Oberpullendorf ein stationäres Hospiz in Betrieb genommen werden.
Mobile Palliativteams: MPT Nord: 0664/8833 5810
MPT Süd: 0664/8833 5820
Mobile Kinder-Palliativteams – Verein MOKI: 0699/166 777 70
Palliativstation Krankenhaus Eisenstadt: 02682/601 2910
Patientenanwaltschaft Burgenland: 02682/600-7010
Telefonseelsorge – 24 h erreichbar unter 142 (kostenlos, anonym)
Landesverband Hospiz Burgenland: 0660/15 55 722
Weitere Artikel zu diesem Thema
Lifestyle
8 Min.
Cortisol ist nicht der Feind
Warum Cortisol unseren Alltag steuert und wie wir lernen, im richtigen Rhythmus zu leben.
Fühlt man sich oft gestresst, müde oder gereizt, kann das viele Ursachen haben. Eine davon: ein Cortisolspiegel im Ungleichgewicht. Mit diesen fünf Tricks habe ich mein Cortisol gesenkt!“ – „So bringst du dein Stresshormon runter!“ – „In nur einer Woche bin ich mein Cortisol-Face losgeworden!“ So oder so ähnlich beginnen viele Videos, die auf TikTok … Continued
8 Min.
Lifestyle
2 Min.
Laufen im Winter? Klappt super – mit diesen 6 Tipps.
Warm, Sichtbar, Sicher.
Lieber langsam als frierend Im Winter lohnt es sich, das Tempo bewusst zu drosseln. So atmet man weniger kalte Luft ein und bleibt stabil – besonders auf nassen oder vereisten Strecken. In Kurven oder bergab gilt: kürzere Schritte, weniger Risiko. Auch die Laufdauer sollte nicht übertrieben werden. Kälte setzt dem Körper mehr zu als man … Continued
2 Min.
Lifestyle
2 Min.
Das sind die Gesundheitstrends 2026!
So entwickelt sich der Gesundheitsmarkt 2026
2026 steht ganz im Zeichen von Technologie, Prävention und Lebensqualität: Gesundheit wird individualisiert, digital unterstützt und ganzheitlich gedacht, weg von reaktiver Medizin hin zu proaktiver, datengetriebener und alltäglicher Gesundheitsgestaltung. Smarte Helfer Als logisches Resultat dieser Entwicklung boomen aktuell Tech-Gadgets, Tracking Apps und digitale Gesundheitsmodelle. Neben smarten Zyklus-Trackern wie “Flo” und Schlaf-Apps “Sleep Cycle” wird die Künstliche Intelligenz 2026 … Continued
2 Min.
Mehr zu Gesundheit

Abo