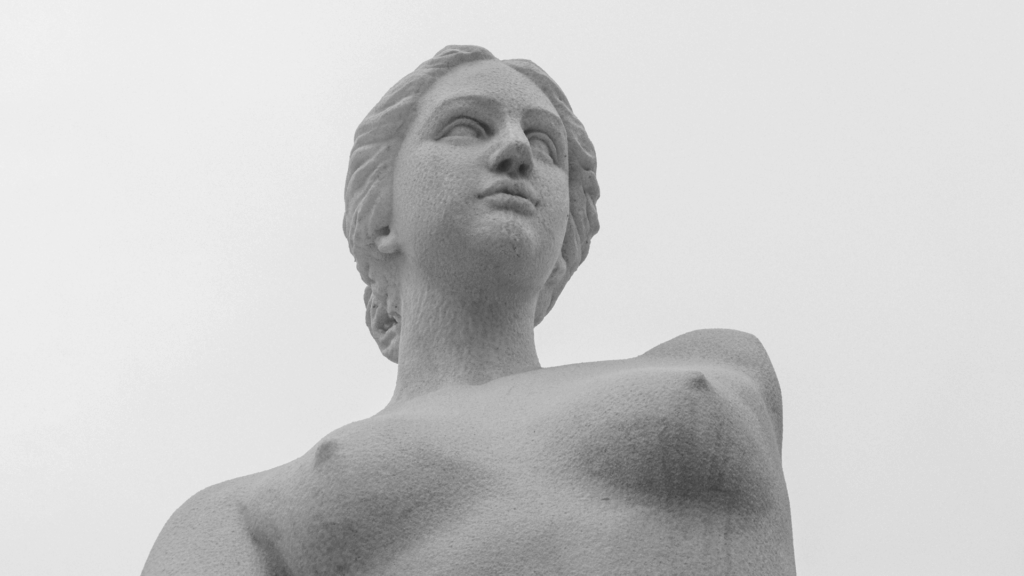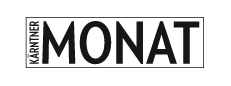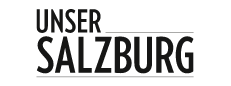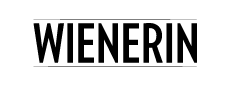Gewalt beginnt leise: Gewaltpräventionsexpertin im Interview
Anja Ebenschweiger vom Mobbingzentrum Österreich beantwortet die wichtigsten Fragen
© Shutterstock
Ein Ort, der schützen soll, wurde zum Schauplatz von Angst und Gewalt. Der Amoklauf an der Grazer Schule BORG Dreierschützengasse im Juni erschüttert und zeigt einmal mehr, wie dringend wir hinschauen müssen. Wir haben mit Gewaltpräventionsexpertin Anja Ebenschweiger gesprochen.
Man hört kein Krachen, kein Splittern. Und doch zerbricht etwas. Jeden Tag, leise und unsichtbar – ein Lächeln, ein Selbstbild, ein Kind. Es geschieht an Schulhöfen, in Klassenzimmern und in den digitalen Schatten der sozialen Netzwerke. Wenn ein weiteres Kind sich im Pausenhof immer näher an die Wand drückt und plötzlich leiser spricht, dann sind es viele kleine Stiche ins Herz, die unter Kindern und Jugendlichen verteilt werden. Mobbing ist kein Streit unter Kindern. Es ist ein schleichendes Gift.
Jede:r zehnte Jugendliche in österreichischen Schulen ist laut Bildungsdirektion Steiermark Opfer von Mobbing – ein ernsthaftes Problem mit vielfältigen Erscheinungsformen und negativen Folgen für alle Beteiligten. Nach dem tragischen Amoklauf am Grazer BORG Dreierschützengasse geriet zunächst das Thema Mobbing in den Fokus – der Täter wurde früh als mögliches Opfer anhaltender Ausgrenzung gehandelt. Inzwischen sind diese Stimmen leiser geworden, die Hintergründe komplexer.
Und dennoch sind durchdachte Mobbingpräventionen im Lebensraum Schule notwendig, um Gewalt im Klassenzimmer entgegenzuwirken. Doch welche Strategien braucht es, wann besteht erster Handlungsbedarf und welche Hilfe gibt es für Betroffene? Fragen, auf die uns Gewaltpräventionsexpertin Anja Ebenschweiger vom Mobbingzentrum Österreich Antwort liefern kann. Ebenschweiger unterstützt Pädagog:innen, Eltern und Jugendliche mit systemischer Prävention und Intervention durch ein Sozialtraining in der Kindergartengartengruppe oder Schulklasse inklusive Pädagog:innen-Weiterbildung und Elterninformation.

Gewaltpräventionsexpertin im Interview
Welche Formen von Mobbing sind besonders häufig an Schulen zu beobachten?
Anja Ebenschweiger: Mobbing ist ein systemisches Gewaltphänomen, das über einen längeren Zeitraum wiederholt durch Gewalt gegen Körper, Seele und Eigentum erfolgt und durch ein Machtungleichgewicht ausgelöst wird – es ist also kein Kampf zwischen Gleichstarken. An Schulen sind sogenannte Testphasen – Schüler:innen mit einem erhöhten Bedürfnis nach Macht und Anerkennung testen, wer sich zum Herabwürdigen eignet – und die Konsolidierungsphase, wo betroffene Kinder wiederholt attackiert werden und sich klare Rollen in der Gruppe verteilen, zu beobachten.
Welche Anzeichen sollten Eltern und Lehrer:innen beachten, um frühzeitig zu erkennen, dass Jugendliche gemobbt werden?
Opfer ziehen sich zurück, klagen vor der Schule über Bauch- oder Kopfschmerzen, schlafen schlecht oder zeigen andere Verhaltensveränderungen. Das Hauptszenario bei Mobbing ist aber das Schweigen aller Schüler:innen. Buben werden oft selbst aggressiv, Mädchen verletzen sich eher selbst. Kinder warten vor der Klassentür auf Lehrer:innen oder stehen in der Pause in der Nähe der Lehrpersonen.
Was wären nun die ersten Schritte bei Mobbing-Verdacht?
Atmen Sie zunächst tief durch und überlegen Sie gemeinsam mit dem Kind, welche Schritte sinnvoll sein könnten. Eltern sollten zuerst zuhören und ihre Kinder trösten – aber auf keinen Fall schlechte Ratschläge geben wie: „Geh dem oder denen aus dem Weg!“ oder „Wehr dich!“. Kontaktieren Sie keinesfalls die Eltern der Mobber:innen, geben Sie niemandem öffentlich die Schuld und gehen Sie nicht in die Klasse, um die Kinder aufzufordern, damit aufzuhören. Damit zerstören Sie die Souveränität Ihres eigenen Kindes und verschlimmern die Situation. Führen Sie mit Ihrem Kind ein Tagebuch, weil es der Psyche hilft und für Außenstehende einen Prozess und eine Struktur aufzeigt.
Wie sollen Lehrer:innen aktiv Unterstützung für Schüler:innen anbieten?
In vielen Fällen wissen Lehrer:innen nicht, dass es in ihrer Klasse Mobbing gibt, weil die Kinder, die andere mobben, hoch intelligent und manipulativ sind und die Mobbinghandlungen meist dann setzen, wenn kein Erwachsener dabei ist. Lehrer:innen sollten für Gespräche zur Verfügung stehen, ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Schüler:innen aufbauen und damit die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Schüler:innen sich einem Lehrpersonal anvertrauen. Gleichzeitig können Lehrer:innen klare Regeln mit der Klasse erarbeiten und auch Konsequenzen bei Verstoß kommunizieren.
Und welche Strategien empfehlen Sie Jugendlichen, um sich selbst gegen Mobbing zu wehren?
Jede:r hat das Recht, sich bei einem Angriff körperlich zu wehren, doch Mobber:innen nutzen ein solches Verhalten auch für sich als Strategie: Bei einer Konsolidierungsphase gibt es in Zwangskontexten wie Kindergartengruppen oder Klassen neben Mobber:in auch Verstärker:innen. Wenn sich dieses Opfer körperlich wehrt, beklagt die Gruppe diese Situation bei den Pädagog:innen und es kommt im Laufe der Zeit zu einer Opfer-Täter-Umkehr. Betroffene Kinder und Jugendliche sollten sich Unterstützung bei Erwachsenen suchen.
Welche präventiven Maßnahmen können Schulen ergreifen, um Mobbing oder Gewalt von vornherein zu vermeiden?
Es ist wichtig, in den Klassen die Empathie und das gegenseitige Mitgefühl zu fördern. In dem Training „Achtung Mobbing!“ wird daran gearbeitet, die große Anzahl an Schüler:innen, die das Mobbing nicht in Ordnung finden, aber aus den unterschiedlichsten Gründen schweigen, zu aktivieren und den Resonanzboden für das Mobbing zu entziehen. Gleichzeitig werden die Kinder in der Klasse emotional berührt, was zu einem Perspektivenwechsel und im besten Fall zu einer Verhaltensänderung führen kann. Denn Menschen lernen in der Auseinandersetzung mit den Folgen des eigenen Handelns.
Was sind die wichtigsten Elemente eines effektiven Mobbing-Präventions-Programms?
Am Anfang steht immer der Vertrauensaufbau, daher kann ein wirksames Mobbing-Präventions- und -Interventions-Programm nicht in drei Stunden abgehalten werden. Wir arbeiten acht bis zehn Schulstunden an zwei oder drei Vormittagen mit Schüler:innen, wobei der Klassenvorstand verpflichtend anwesend sein muss. Es braucht emotionale Berührung und Folgenkonfrontation. Zudem werden Helfersysteme für die betroffenen Kinder und ein Unterstützungssystem in der Klasse etabliert, das in engem Austausch mit Lehrer:innen steht, damit in und mit der Klasse auch in den Wochen danach kontinuierlich nachgearbeitet werden kann.
Wie können Eltern und Lehrer:innen dazu beitragen, das Risiko von extremen Reaktionen wie Amokläufen zu verringern, die oftmals aus Mobbing resultieren?
Von Mobbing betroffene Kinder und Jugendliche reden zwar davon, aber nicht ausreichend und finden so kaum Gehör. Es bräuchte seitens der Eltern und Pädagog:innen mehr Aufmerksamkeit und mehr Bereitschaft, aktiv zuzuhören und zu helfen. Über das Thema Mobbing hinweg bräuchte es an Schulen das präventive Vorbereitungsprogramm „Einsatzort Schule“ mit jährlichen Schulungen. Amoktaten werden von den Tätern online beinahe immer in einer Form angekündigt. Dieses Phänomen nennt sich Leaking, doch auch darauf sind Schulen in Österreich nicht vorbereitet. Eine Prävention im klassischen Sinn kann es bei Amoktaten nicht geben. Gleichwohl gibt es Chancen der Früherkennung.
Kinder nach Extremsituationen oder Gewalt unterstützen
Wenn Kinder Zeugen oder indirekt Betroffene von Amokläufen, Terroranschlägen etc. werden, geraten ihre Grundannahmen über die Welt ins Wanken.
Drei Grundüberzeugungen werden dabei oft erschüttert:
- Die Verstehbarkeit und Sinnhaftigkeit der Welt
- Der Glaube an die Gutartigkeit anderer Menschen
- Das Gefühl von Kontrolle und eigenem Selbstwert
Kinder reagieren auf solche Ereignisse sehr unterschiedlich.
Häufig zeigen sie:
- Angst, Trennungsängste oder allgemeine Unsicherheit
- Wut, Rückzug oder sogar Rachefantasien
- Schuldgefühle, besonders bei persönlicher Betroffenheit
- Konzentrationsprobleme, Schlafstörungen oder Regression
(Rückfall in frühere Verhaltensweisen)
Was hilft Kindern in solchen Ausnahmesituationen?
Zunächst brauchen sie Sicherheit und Verbundenheit. Erwachsene sollten präsent sein, beruhigend wirken und offen für Gespräche sein. Dabei ist es wichtig, den Kindern zu vermitteln: Die Welt ist nicht grundsätzlich gefährlich – es handelt sich um ein extremes Ereignis, nicht um einen Dauerzustand.
Hilfreiche Maßnahmen im Überblick:
- Beantworten Sie die Fragen der Kinder offen und ehrlich,
altersgerecht und ohne Dramatisierung. - Lassen Sie Raum für Gefühle – auch nonverbal, etwa durch
Zeichnen, Bewegung oder Spiel. - Nehmen Sie Sorgen ernst.
- Fördern Sie Kontakte zu Gleichaltrigen und stärken Sie die
Peer-Group als Ressource. - Bieten Sie Alltagsstruktur und Routinen.
- Begrenzen Sie Medienkonsum und besprechen Sie gemeinsam Inhalte.
- Zwingen Sie das Kind nicht, sich mit belastenden Informationen
zu konfrontieren – Selbstschutz geht vor. - Ermutigen Sie, bei Bedarf professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Anlaufstellen & Notrufnummern
Akute Notfälle bei Gewalt:
- Rettung: 144
- Polizei: 133
- Krisenintervention Steiermark: 130
Telefonische Hilfe (0–24 Uhr):
- Rat auf Draht (für Kinder & Jugendliche): 147
- Krisenhotline PsyNot: 0800/44 99 33
- Telefonseelsorge: 142
- Kindernotruf: 0800/567 567
- Ö3-Kummernummer (16–24 Uhr): 116 123
- Hotline der Schulpsychologie
(Mo–Fr 8–20 Uhr, Sa 8–12 Uhr): 0800/211 320
Das könnte dich zum Thema Gewalt auch interessieren:
- Was kann ein Therapie-Gespräch mit ChatGPT?
- Toxische Beziehung: So erkennst du die Anzeichen
- Keine Angst vor der Angst: Die Bedeutung unserer wichtigsten Emotion
Die Autorin dieses Beitrags:

Yvonne Hölzl, Redakteurin der STEIRERIN, ist verantwortlich für die Rubrik Style und Wohnen. Neben ihrer Kreativität beim Schreiben zeigt sie auch handwerkliches Geschick, wenn sie handgemachte Strickwerke zaubert. In ihrer Freizeit ist die Naturliebhaberin mit ihrem Windhund Toto oft im Wald anzutreffen.
Weitere Artikel zu diesem Thema
People
10 Min.
“Die Zukunft entsteht im Hier und Jetzt” – Trendforscher Harry Gatterer im Interview
Welche Trends unser Leben in den kommenden Jahren bestimmen und was es braucht, um darauf zu reagieren.
Welche Trends unser Leben in den kommenden Jahren bestimmen und was es braucht, um darauf zu reagieren, wollten wir von Trendforscher Harry Gatterer wissen. Er sagt: Die Zukunft ist kein Zufall, und Glaskugeln helfen auch nicht weiter. Die Zukunft hat derzeit keinen einfachen Stand. Wer die Zeitung aufschlägt oder durch den Newsticker scrollt, liest von … Continued
10 Min.
Mehr zu Lifestyle

Abo