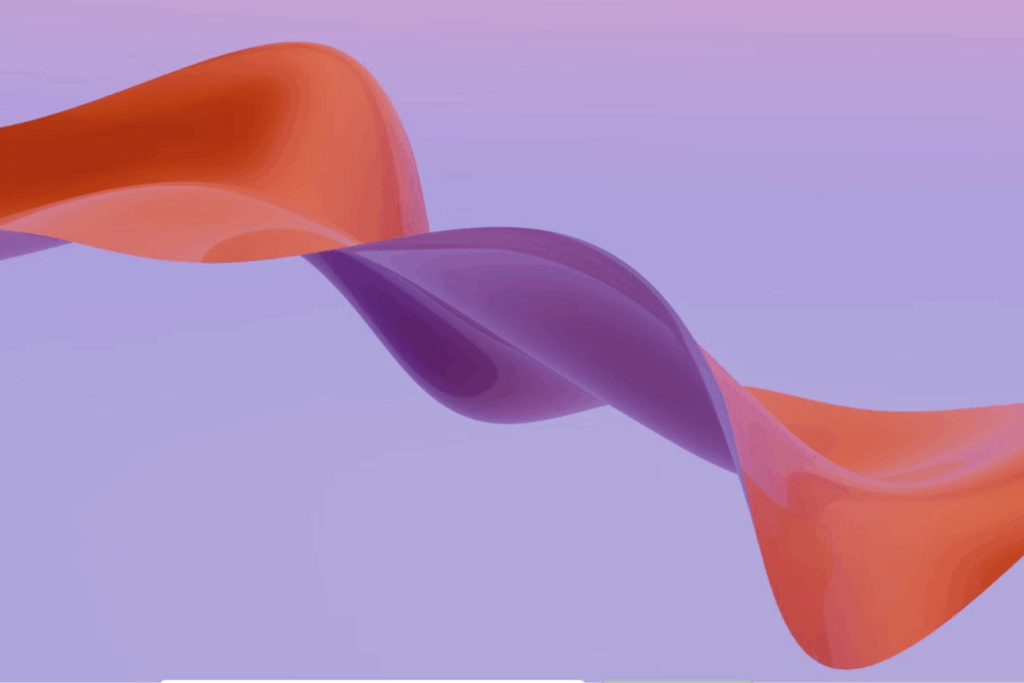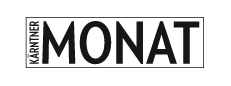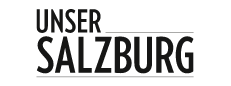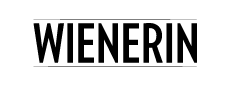Brustrekonstruktion nach Brustkrebs: Was man darüber wissen sollte
Plastischer Chirurg Daniel Popp im Interview über moderne Methoden, Ängste und warum Aufklärung Leben retten kann.
© Shutterstock
Jede achte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs – und viele von ihnen stehen vor der Frage: Rekonstruktion, ja oder nein? Im Gespräch gibt Daniel Popp, Facharzt für Plastische, Ästhetische & Rekonstruktive Chirurgie in Graz, Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema Brustrekonstruktion nach Brustkrebs.
Der Oktober steht traditionell ganz im Zeichen der Pink-Ribbon-Kampagne. Wieso ist dieser Monat auch für Sie als plastischer Chirurg von Bedeutung?
Daniel Popp: Die Vorsorge und Früherkennung liegen primär im Verantwortungsbereich der Gynäkologen, aber auch der Hausärzte – das ist ihre Domäne. Dennoch spielt der Pink-Ribbon-Monat auch für mich eine wichtige Rolle. Er richtet den Fokus auf eine Erkrankung, die so viele Frauen betrifft, und auf die Frage, wie das Leben nach einer Brustkrebsdiagnose weitergeht. Brustkrebs ist eine tiefgreifende Zäsur, die medizinisch, aber auch emotional verarbeitet werden muss. Wenn ich durch Aufklärung dazu beitragen kann, dass mehr Frauen Vorsorgeuntersuchungen ernst nehmen und rechtzeitig handeln, dann kann das im besten Fall Leben retten. Und auf einer zweiten Ebene ist es mein Anliegen, betroffenen Frauen mit modernen Rekonstruktionsmöglichkeiten ein Stück Normalität zurückzugeben.
Die Wiederherstellung der Brust – für viele Patientinnen mehr als nur ein ästhetischer Eingriff. Welche Rolle spielt sie für das Selbstwertgefühl und die Lebensqualität?
Eine sehr große. Gesundheit definiert sich ja bekanntlich nicht nur durch das Fehlen von Krankheit, sondern durch vollständiges körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden. Frauen, die sich für eine Rekonstruktion entscheiden, tun das nicht aus Eitelkeit. Es geht nicht um Perfektion. Es geht darum, im Alltag möglichst wenig an die Erkrankung erinnert zu werden – weder im Spiegel, noch bei sozialen Interaktionen, noch in der Intimität mit dem Partner. Eine rekonstruierte Brust kann dazu beitragen, dass die Frau sich wieder vollständig und „ganz“ fühlt. Diese emotionale Dimension darf man keinesfalls unterschätzen.
Zur Wahl der Methoden: Implantate, Eigengewebe und Co – welche Möglichkeiten stehen heute zur Verfügung?
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Rekonstruktionen mit Fremdmaterial – also Implantaten – und solchen mit Eigengewebe. Auch muss zwischen einer Sofortrekonstruktion und einer sekundären Rekonstruktion, also mit zeitlichem Versatz zur onkologischen Operation, unterschieden werden. Bei den Implantaten wird häufig zunächst ein Gewebeexpander eingesetzt, um Platz zu schaffen, bevor das endgültige Implantat eingebracht wird. Bei den Eigengewebsverfahren gibt es zwei Varianten: das Lipofilling – bei dem körpereigenes Fett meist von Bauch oder Oberschenkel abgesaugt und in die Brust transplantiert wird – oder die viel komplexere Technik mit einem freien Gewebstransfer, bei der Gewebe – etwa vom Bauch oder Oberschenkel – mitsamt Gefäßen transplantiert und mikrochirurgisch angeschlossen wird. Jede dieser Methoden hat ihre Berechtigung, und die Entscheidung hängt von der individuellen Situation und den Wünschen der Patientin ab.
Worin unterscheiden sich die beiden Ansätze – Implantat versus Eigengewebe?
Die implantatbasierte Rekonstruktion ist technisch die einfachere Lösung, bringt aber langfristig mehr mögliche Komplikationen mit sich. Kapselfibrosen, Infektionen oder sichtbare Implantatränder sind mögliche Probleme. Implantate sind zudem nichts für die Ewigkeit – meist sind Folgeeingriffe notwendig.
Die Eigengewebsrekonstruktion ist aufwendiger, Operationen dauern viele Stunden und bergen ein gewisses Risiko, etwa dass das Gewebe nicht durchblutet wird. Das Risiko dafür ist aber verhältnismäßig gering und man hat dafür ein dauerhaftes Ergebnis ohne Fremdmaterial. Aber auch hier sind meist mehrere kleinere Korrekturen notwendig.

Implantate entwickeln sich stetig weiter. Welche neuen Ansätze gibt es hier?
Lange Zeit waren makrotexturierte Implantate Standard, die stabiler sind, sich aber oft weniger natürlich anfühlen. Einen möglichen Wandel zu weniger Komplikationen bei implantatbasierten Rekonstruktionen könnte es durch technologische Fortschritte geben – einerseits durch gewebeschonende, sog. minimalinvasive Techniken der Mastektomie, u. a. roboter- und kameraassistiert, andererseits durch die neueste Implantatgeneration, welche eine spezielle feine Oberfläche besitzen – sie gelten technisch gesehen als glatt, sind aber nanotexturiert und haben ein besonders verformbares Gel mit einer weicheren, aber belastbareren Hülle. Dadurch fühlen sie sich um vieles weicher und natürlicher an und sind auch laut neuesten Daten besser verträglich als die Implantate, die bisher am Markt verfügbar waren. Allerdings fehlen in der Rekonstruktion noch Langzeitergebnisse damit. Und leider gibt es nach wie vor nicht das perfekte Implantat – jede Lösung hat ihre Stärken und Grenzen.
Mit welchen Sorgen und Ängsten kommen Patientinnen typischerweise zu Ihnen?
Die meisten Patientinnen sind schon sehr informiert und kommen mit einer klaren Vorstellung. Bei der Eigengewebsrekonstruktion ist es häufig die Angst vor einer langen Narkose. Ich bin seit über zwölf Jahren Chirurg und habe bei einem Elektiveingriff noch keinen relevanten Narkosezwischenfall erlebt. Trotzdem bleibt diese Sorge präsent, weil eine Narkose für viele Menschen einen Kontrollverlust bedeutet.
Darüber hinaus sind es sehr individuelle Befürchtungen: Die eine Patientin sagt klar: „Ich will kein Implantat in meinem Körper“, die nächste lehnt eine lange Operation mit Eigengewebe ab. Manchmal ist die Wahl auch durch die medizinische Situation vorgegeben – etwa, wenn die Haut bei der Mastektomie aus onkologischen Gründen nicht erhalten werden kann oder wenn bestrahlt werden muss. Beide Situationen erfordern häufiger eine Eigengewebsrekonstruktion. Wichtig ist, jede Patientin dort abzuholen, wo sie steht, und ihr transparent die Vor- und Nachteile aufzuzeigen. Die Entscheidung wird immer gemeinsam mit der Patientin getroffen, um individuell die für die Patientin beste Option zu finden.
Entscheiden sich auch manche Frauen bewusst gegen eine Rekonstruktion?
Ja, das kommt durchaus vor. Auch wenn sich die meisten Patientinnen, die zu uns kommen, eine Rekonstruktion wünschen, gibt es Frauen, die nach dem Beratungsgespräch sagen: „Ich bin so, wie ich jetzt bin, eigentlich zufrieden.“ Manche möchten lediglich eine Anpassung der gesunden Brust, damit das Gesamtbild harmonischer ist oder eben weniger Probleme am Bewegungsapparat entstehen. Hier spielt das Alter eine Rolle: Eine Frau Mitte 30 geht meist anders mit diesem Thema um als eine Frau Ende 60. Wir respektieren jede Entscheidung und begleiten die Patientinnen auf dem Weg, der für sie am besten passt.
Eine wichtige Frage für viele Frauen: Werden die Kosten von der Krankenkasse übernommen?
In Österreich – so wie meines Wissens nach in allen Ländern Mitteleuropas – sind wir in der privilegierten Situation, jeder betroffenen Frau eine Rekonstruktion anbieten zu können. Die Krankenkassen übernehmen nicht nur die eigentliche Rekonstruktion, sondern auch sämtliche notwendigen Folgeeingriffe wie Implantatwechsel oder notwendige Korrekturen. Das gibt den betroffenen Frauen Sicherheit, nachdem sie eh schon eine Situation durchmachen oder durchgemacht haben, die oft verunsichert.
Zum Abschluss: Welche Botschaft möchten Sie Frauen im Rahmen des Pink-Ribbon-Monats mitgeben?
Mein Appell ist eindeutig: Vorsorge rettet Leben. Jede Frau sollte lernen, ihre Brust regelmäßig selbst zu untersuchen und Veränderungen ernst nehmen und rasch abklären zu lassen. Darüber hinaus sind die modernen bildgebenden Verfahren wie Ultraschall, MRT, aber nach wie vor auch die klassische Mammografie wichtige Instrumente, die unbedingt in den empfohlenen Abständen gemacht werden sollten.
Besonders Frauen mit familiärer Vorbelastung oder genetischen Risikofaktoren sollten früh und engmaschig kontrolliert werden. Je früher Brustkrebs entdeckt wird, desto besser sind die Heilungschancen. Das Wichtigste ist: keine Angst vor der Vorsorgeuntersuchung. Frauengesundheit geht uns alle etwas an, aber jede einzelne Frau ist selbst für ihren Körper und ihre Gesundheit verantwortlich – und dazu zählt auch die Früherkennung. Mein Traum wäre es, dass die Wissenschaft eine Möglichkeit findet, Brustkrebs zu besiegen, und wir Plastische Chirurgen gar keine Brustrekonstruktionen mehr machen müssen.
Das könnte dich neben Brustrekonstruktion nach Brustkrebs auch interessieren:
Weitere Artikel zu diesem Thema
Lifestyle
2 Min.
Helfen mit Sinn: Warum junge Frauen bei Europa-Ambulance mitmachen
Europa-Ambulance bietet flexible Einstiegsmöglichkeiten für engagierte Frauen im Rettungsdienst und Krankentransport.
Die Sinnfrage wird für die junge Generation zunehmend zentral, auch wenn es um berufliches oder freiwilliges Engagement geht. Die gemeinnützige Organisation Europa-Ambulance, bundesweit im Krankentransport, Rettungsdienst und Rückholdienst aktiv, setzt genau hier an: mit flexiblen Beteiligungsmodellen, die besonders junge Frauen ansprechen. Im Mittelpunkt stehen dabei Werte wie Empathie, Teamgeist und fachliche Kompetenz. Veränderte Ansprüche: Rettungsdienst … Continued
2 Min.
Lifestyle
3 Min.
Krankenschwester Sandra Klemencic über moderne Pflege in der Steiermark
Sandra Klemencic steht für häusliche Pflege, Empathie und digitale Pflegequalität in der Steiermark.
Die Herausforderungen in der häuslichen Pflege sind heute vielschichtiger denn je: Pflegebedürftige Menschen und ihre Familien stehen nicht nur vor organisatorischen, sondern auch vor emotionalen und technologischen Fragen. Sandra Klemencic, freiberufliche Krankenschwester in der Steiermark, begegnet diesen Anforderungen mit einem Ansatz, der menschliche Nähe und digitale Tools gezielt verbindet. Ihr Ziel: Eine Pflege, die sowohl … Continued
3 Min.
Lifestyle
8 Min.
Cortisol ist nicht der Feind
Warum Cortisol unseren Alltag steuert und wie wir lernen, im richtigen Rhythmus zu leben.
Fühlt man sich oft gestresst, müde oder gereizt, kann das viele Ursachen haben. Eine davon: ein Cortisolspiegel im Ungleichgewicht. Mit diesen fünf Tricks habe ich mein Cortisol gesenkt!“ – „So bringst du dein Stresshormon runter!“ – „In nur einer Woche bin ich mein Cortisol-Face losgeworden!“ So oder so ähnlich beginnen viele Videos, die auf TikTok … Continued
8 Min.
Lifestyle
2 Min.
Laufen im Winter? Klappt super – mit diesen 6 Tipps.
Warm, Sichtbar, Sicher.
Lieber langsam als frierend Im Winter lohnt es sich, das Tempo bewusst zu drosseln. So atmet man weniger kalte Luft ein und bleibt stabil – besonders auf nassen oder vereisten Strecken. In Kurven oder bergab gilt: kürzere Schritte, weniger Risiko. Auch die Laufdauer sollte nicht übertrieben werden. Kälte setzt dem Körper mehr zu als man … Continued
2 Min.
Mehr zu Gesundheit

Abo